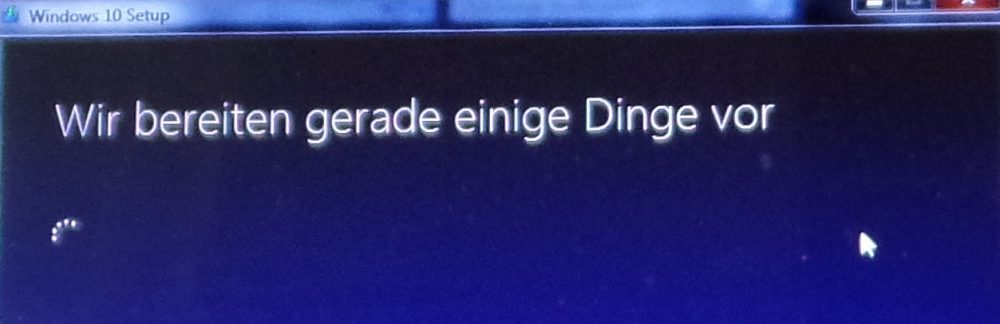Eine ganze Weile lang hab ich für ein Theater in einer süddeutschen Stadt, nennen wir sie S., Kabarettprogramme und Texte geschrieben. Der Leiter dieses Theaters, nennen wir ihn Herrn W., hatte einen liebenswürdigen Spleen: Für Menschen, in deren Vertrag stand, dass er für deren Hotelaufenthalt in besagter süddeutschen Stadt aufzukommen habe, suchte er gern Häuser aus, die sein Budget nicht allzu sehr belasteten. Er scheute wohl die Kosten, aber nicht die Mühen, denn die Häuser, die Herr W. für seine Künstler auswählte, findet man nicht in Allerwelts-Reiseführern. Nach derartigen Perlen der Hotellerie, die ihre Gäste nicht mit hochwertiger Einrichtung oder zuvorkommendem Service irritieren wollen, die sich ausdrücklich an „preisbewusste Reisende, die einen sportlichen Komfort bevorzugen“ wenden und keine Zugeständnisse an einen oftmals flüchtigen Zeitgeist („Wer braucht denn ein WC auf dem Zimmer? Nachts wird geschlafen, nicht gepieselt!“) machen, muss selbst der Kenner lange suchen. Herr W. trieb sie unfehlbar auf, und so sind mir die Häuser, in denen ich auf seine Kosten nächtigte, unauslöschlich in Erinnerung geblieben. Doch eins von ihnen ragt auch noch jetzt, über 5 Jahre, nachdem ich zuletzt in ihm genächtigt habe, über die anderen Geiz-ist-geil-Domizile hinaus: Das Hotel R., die Absteige aller Absteigen, die Mutter aller Bruchbuden.
Es begann damit, dass ich am späten Sonntagnachmittag ankam und vor verschlossener Türe stand. Hervorquellenden Auges las ich das Schild am Eingang: „Rezeption täglich von 8 bis 18 Uhr besetzt, Sonntags Ruhetag“. Soso. Gut zu wissen. Und ganz schön pfiffig, die ganze Unternehmensphilosophie in 10 Worten zusammengefasst an die Tür zu schreiben. Trotzdem: irgendwie musste ich ja mein Zimmer beziehen… und da entdeckte ich diesen kleinen Zettel, der in der verschlossenen Eingangstür klemmte. Da stand mein Name und eine Telefonnummer drauf, unter der ich den Regisseur des Kabarett-Programms erreichte, an dem ich gerade schrieb. Der musste auf Geheiß von Herrn W. und der Hoteldirektion meinen Zimmerschlüssel bereit halten und war darob etwas missgestimmt. Hatte sich die Tätigkeit als Regisseur wohl anders vorgestellt. Typisch Kunst-Fuzzi. Egal, Hauptsache, ich war drin.
An der Aufzugtür hing noch ein Schild („Den Lift nach 18 Uhr und sonntags nicht benutzen!“), das ich souverän ignorierte. Mein Zimmer lag im dritten Stock, mein Koffer war schwer und der Regisseur schützte einen Bandscheibenvorfall vor. Also hinein in den Lift. Drinnen wusste ich, warum draußen das Schild hing. Drinnen hing nämlich noch eins: „Wenn er steckenbleibt, keine Panik. Am Notschalter dreimal hintereinander schnell ein- und ausschalten, bis zehn zählen und wieder einschalten. Dann geht er meistens wieder.“
Wie durch ein Wunder erreichte ich unfallfrei mein Zimmer, wo mir die Tränen der Rührung in die Augen traten. Die Hoteldirektion hatte extra für mich ein Zimmer ausgewählt, das in meinem Geburtsjahr tapeziert und möbliert worden und seitdem von keines Handwerkers Hand mehr angerührt worden war! Gleiches galt übrigens auch für die Etagen-Toilette, die niemand vergessen kann, der sie jemals gerochen hat.
Am nächsten Morgen durfte ich dann ein weiteres Highlight des R. erleben, die Frühstücksdirektorin. Noch mit den üblichen morgendlichen Nebeln kämpfend hatte ich mich im halbwachen Zustand in den Frühstücksraum geschleppt, war an einem Buffet vorbeigestolpert, auf dem die Salami vor sich hin schwitzte und der Käse gegen die ihn gefangen haltende Plastikhülle drängte, und hatte mich in einen freien Rattan-Stuhl geworfen. Ãch war der einzige Gast im Frühstücksraum. Wie friedlich. Wie entspannend. Nur noch fünf Minütchen die Augen schließen… „Gute Morge, was derfit Ihna bringa?“ Die Trompeten von Jericho waren ein Scheißdreck gegen das Organ der Frühstücksdirektorin. Es ist das Privileg der angejahrten Schwäbin, aggressiv schreiend fisteln zu können, und die Frühstücksdirektorin nutzte dieses Privileg bis zum Exzess. Mit einem enervierenden Klingeln im Ohr, das den ganzen Tag nicht vergehen wollte, orderte ich Kaffee und „ein weiches Ei, aber bitte wirklich weich, allerhöchstens 3 Minuten“. Ich Optimist. Zusammen mit dem Kaffee, an dem ich mir gottserbärmlich die Zunge verbrannte, servierte mir die Frühstücksdirektorin Service-Interna: „Des Ei bring i Ihne, wenn’s fertig is.“ Das sind natürlich Insider-Informationen, die einen morgens um acht entscheidend weiterbringen. Und wenig später brachte sie mir mit heimtückischem Grinsen ein knallhartes Ei mit grünem Dotter, dessen Aggregatzustand sie mit einem gellend hervorgestoßenen „En gutes Ei braucht 5 Minute!“ erläuterte. Eine brave Frau, die wusste, was gut für ihre Gäste ist und ihnen konsequent in lebenswichtigen Fragen wie der Salmonellenvorsorge kein Mitspracherecht einräumte!
Im Verlauf des Tages musste ich verwundert feststellen, dass das Hotel R. nicht vorsah, dass seine Gäste tagsüber in ihren Zimmern weilten. Die Heizung hatte sich um 7 Uhr abgestellt, und sie blieb aus. Meine Bitte um ein wenig Wärme beschied die mittlerweile anwesende Rezeptionsangestellte abschlägig: „Wegen Ihnen geht die Fernheizung nicht an.“ Nun ja, ich gestehe es ungern, aber die Kälte hatte auch ihr Gutes: Ich erledigte mein tägliches Schreibpensum notgedrungen schnell und diszipliniert, um geheizte Räumlichkeiten aufsuchen zu können. Und um dem Hotel R. entfliehen zu können. Hätte Herr W. mich auch nur ein bisschen besser bezahlt, hätte ich mir auf eigene Kosten ein anderes Hotel genommen. Aber Herr W. gab für seine Künstler nicht viel mehr Geld aus als für ihre Hotelzimmer.
Am letzten Abend im Hotel R. hatte ich mir eine Flasche anständigen Rotwein mit aufs Zimmer genommen, mit der ich meinen bevorstehenden Abschied feierte, als gegen 23 Uhr Türenschlagen und laute Stimmen vom Hotelparkplatz meine Aufmerksamkeit weckten. „Ich fass es nicht, der W. hat uns wieder in dieses Dreckloch gesteckt!“ wetterte der Frontmann einer Berliner Kabarettgruppe, der aus seinem Auto stieg. „Erst brenn ich das Drecksloch ab, und dann bring ich den W. um!“
„Ich helf bei beidem gern!“ rief ich dem Kollegen aus dem Fenster zu, der daraufhin erfreut zu mir ins Zimmer eilte und mir beim Rotweintrinken half. Am nächsten Tag verschlief ich prompt, weil der vereinbarte Weckruf der Rezeption ausgeblieben war. „Das ist nicht meine Schuld. Ich hab fünfmal in Zimmer 11 angerufen, Sie sind nicht drangegangen!“ Konnte ich auch nicht. Ich hatte Zimmer 12.
[tags]Hotelhölle, Service-Inferno, Lohndumping[/tags]