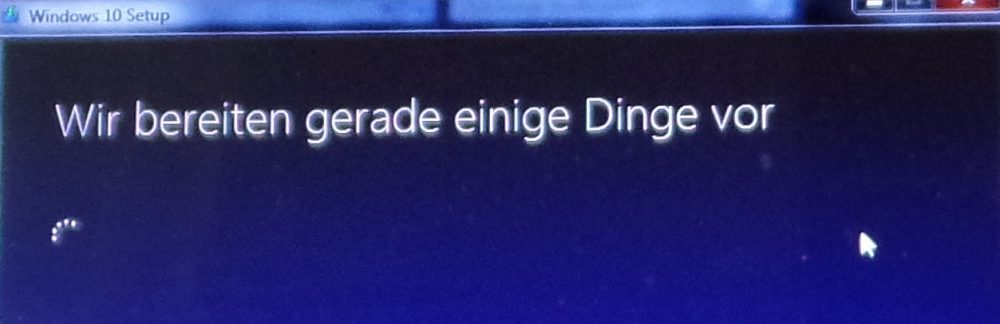Der Mittagesser hat mich drauf gebracht. Er hat mir von einem Ort im Vogelsberg erzählt, wo man gebratene Blutwurst mit Grüner Sauce kombiniert. Gestern hab ich’s endlich ausprobiert.
Fangen wir mit dem einfachsten an, mit der Blutwurst. Wenn man in Berlin lebt, hat man’s am einfachsten, dann braucht man nur nach Neukölln zum Blutwurstritter zu fahren, wo man die beste Blutwurst der Stadt kauft. Der hilft man aus der Pelle (bißchen nass machen hilft), schneidet sie in fingerdicke Scheiben und brät dieselben ohne Fett bei mittlerer Hitze in der Pfanne schön kross. Mehr ist nicht.
Vorher hat man mehlige Kartoffeln geschält, weichgekocht und ausgedämpft, dann hat man sie mit einem Kartoffelstampfer bearbeitet, etwas warme Milch und/oder Bouillon untergerührt, mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss gewürzt und so ein eher festes Kartoffelpüree hergestellt.
Für die Grüne Sauce hat man sich eine größere Menge frischer Kräuter besorgt, was zur Zeit etwas schwierig werden könnte. Die Klassiker Petersilie, Schnittlauch, Pimpernelle, Kerbel, Borretsch, Sauerampfer, Kresse hab ich nicht alle bekommen, aber 4 aus 7 geht auch, die wurden kleingeschnitten, und mit der Saucenbasis (diesmal Schmand mit Buttermilch glatt gerührt, leicht gesalzen) vermengt.
Fehlt noch das Anrichten. Man modelliert aus den Stampfkartoffeln eine Kraterlandschaft auf dem Teller. Die Krater befüllt man mit Grüner Sauce, in die der Esser die am Rand geparkten Blutwurstscheiben vor dem Verzehr andächtig eintunken kann. Wagemutige Naturen wagen in letzter Sekunde einen tollkühnen Berlinisch-Nordhessischen Crossover und ziehen ein paar Fädchen Leinöl über das ganze.
Und wie hat’s geschmeckt? Wie soll ich das beschreiben? Der von Sebastian (ewiger Dank sei dir gewiss!) erwähnte Ort im Vogelsberg ist in meiner Phantasie sofort zum kulinarischen Shangri La mutiert, ich ehre seine Einwohner von Stund als Küchengenies, und eigentlich müsste ich Frage 8 des Kochstocks ergänzen. Gebratene Blutwurst mit Grüner Sauce und Stampfkartoffeln gehört ab sofort zu meinen Standardgerichten.
Archiv der Kategorie: Kochen
Schlachtekohl
Noch so ein kulinarisches Relikt aus versunkener Zeit: der Schlachtekohl. „Da, wo ich herkomme“ (also aus Nordhessen) pflegte man einmal im Jahr zu schlachten, auch wenn man kein Landwirt war. Mit einem solchen trat nämlich der schweinelose Haushaltsvorstand einmal jährlich in Verhandlung (eine hervorragende Ausrede, mit dem Landwirt soviel Schnaps zu trinken, bis weder Haushaltsvorstand noch Landwirt mehr wussten, wer jetzt wen über den Tisch gezogen hatte). Am Ende dieser Verhandlung stand ein Handschlag und eine Geldübergabe an den Landwirt, der sich im Gegenzug bereit erklärte, eine seiner wohlgeratenen, gesunden Sauen ins Jenseits zu befördern und die Überreste derselben unter tatkräftiger Mithilfe aller Mitglieder beider Familien in regionaltypische Spezialitäten (Ahle Worscht, grobe Bratwurst, Weckewerk, Sülze, Garwurst… usw.) zu verwandeln.
Am Schlachttag klingelte der Wecker zu unmenschlich früher Stunde, denn an einer ausgewachsenen Sau können sich auch viele Hände viele Stunden lang abarbeiten. Da wurden die verschiedensten Würste gemacht, Sülze und Schmalz hergestellt, Fleisch wurde eingeweckt… und das bei Bauern, die elektrisch betriebene Geräte für neumodischen Kram („Erst mal abwarten, ob sich das durchsetzt!“ Oder; direkter: „Warum soll ich denn für teuer Geld Geräte kaufen, wenn das die Fremden machen, die für die Sau bezahlt haben?“). Wer schon mal eine Weile an einer handbetriebenen Wurstmaschine gestanden hat, weiß, wie das schlaucht. Stundenlang in der Küche stehen, Gläser sterilisieren, Weckewerk kochen, Schmalz machen und Wurst einwecken ist auch keine ganze Kleinigkeit. Der Schlachttag führte einem von morgens bis abends vor Augen, dass gutes Essen mit Arbeit verbunden ist. Er führte einem aber auch vor Augen, dass es nach harter Arbeit eine Belohnung gibt, denn am Ende des Schlachttages gab es den Schlachtekohl, das gemeinsame Essen aller, die mitgearbeitet hatten.
Traditionell begann der Schlachtekohl mit einem Teller Wurstebrüh. Also einer Bouillon vom Schwein, in der die Würste und zahlreichen Fleischstücke im Lauf des Tages gekocht worden waren. Logisch, dass obenauf goldglänzende Fettaugen schwammen. Logisch, dass die Brühe ungeheuer reichhaltig war. Logisch, dass sie für Menschen, die Brühe aus Pulvern von Maggi und Knorr gewöhnt sind, vermutlich gewöhnungsbedürftig, etwas streng und vielleicht zu „schweinern“ schmecken würde. Für Menschen, die einen Tag lang im Dunstkreis der toten Sau gerackert hatten, schmeckte sie wie Manna, weckte ermüdete Lebensgeister und bereitete Gaumen und Seele auf die kommenden Attraktionen vor.
Da wäre zunächst einmal die frische Bratwurst zu nennen. Nur, wer einmal eine nordhessische grobe, ungebrühte Bratwurst gegessen hat, weiß, was für eine Delikatesse eine einfache Bratwurst sein kann. Und ärgert sich fortan schwarz, wenn er sieht, mit was für todgecutterten, fetttriefenden Ungetümen Menschen im wahrsten Sinne des Wortes abgespeist werden, die an einem „normalen“ Imbiss eine Bratwurst bestellen.
Die Bratwurst für die Kinder, die am Schlachtekohl teilnahmen, war etwas besonderes. Sie war ihnen im Lauf des Tages „angemessen“ worden. Jedes Kind, das beim Schlachtekohl geholfen hat, wurde irgendwann neben die Wurstmaschine gestellt, und ein Stück Darm wurde ihm von einem Ohr zum andern angelegt und gleich mit Wurstmasse befüllt1. Das war die eigene Bratwurst, die man dann abends beim Schlachtekohl verzehrte.
Aber von einer Bratwurst wurde man nach so einem Tag natürlich nicht satt. Und folgerichtig kam mit und nach den Bratwürsten alles, was zur klassischen Schlachteplatte gehört: frische Blut- und Leberwürste, Wellfleisch, Speck, Frikadellen und Weckewerk, begleitet von mehligen Salzkartoffeln und würzigem Sauerkraut, das mit einer gehörigen Portion Schweineschmalz auf Höchstleistung getuned worden war. Das alles wurde mit größeren Mengen des besten Biers der Welt hinuntergespült, und Landwirt und Haushaltsvorstand genehmigten sich das ein oder andere Schnäpschen, um den Kreis endgültig zu schließen.
Anläßlich eines Schlachtekohls habe ich auch erfahren, woher das Wort „bauernschlau“ kommt. Es ist eine Bezeichnung für listige Landwirtinnen, die an der sich biegenden Tafel mit allen psychologischen Tricks arbeiten, um sich selbst und ihrer Sippschaft die besten Stücke zu sichern. Mit folgenden Worten trug eine wackere Landwirtsgemahlin aus dem Meißner Vorland die Platte mit den Würsten und dem Wellfleisch auf: „Das war nun unsere Suse… So ein treues Tier war sie, mit so einem lieben, sanften Blick. Als ich ihr gestern ihr letztes Futter gebracht hab, wie sie da geguckt hat… Ich schwöre, sie hat gewusst, was ihr bevorsteht.“ Klasse Idee, gnä‘ Frau! Auch blitzsauber durchgezogen. Wirklich ganz großes Tennis. Aber eine Spur zu durchsichtig. Wir haben reingehauen, als gäbe es kein morgen.
Kochstock
Sebastian war so freundlich, mir einen Stöckchen zuzuwerfen, nicht ohne anzumerken, dass ich in letzter Zeit zu wenig übers Essen geschrieben hab. Tut leid, ich gelobe Besserung und arbeite gleich mein allererstes Stöckchen ab:
1) Kannst du kochen? Wenn ja, kochst Du gerne?
Ja. Ja, und wie!
2) Wann isst bei Euch die ganze Familie gemeinsam?
Die aus der geduldigsten Gemahlin von allen und mir bestehende Familie speist abends.
3) Was isst Du zum Frühstück?
Paar Löffel Müsli, Vollkornbrötchen, Schinken, Liter Kaffee. Und manchmal, sonntags, englisch: Bacon and Eggs, Sausages, Grilled Tomato, Toast, Orangenmarmelade, Earl Grey.
4) Wann, wo und wie esst ihr in der Woche?
Gefrühstückt und imbisslich gemittagt wird im Büro, abends essen wir zu hause.
5) Wie oft geht Ihr ins Restaurant?
Unterschiedlich, aber mindestens einmal pro Woche. Und in unserem „zweiten Wohnzimmer“, dem Restaurant/Café/Biergarten unter unserer Wohnung, wo sogar unser W-Lan funktioniert, schauen wir beinahe täglich rein, essen aber nicht immer was.
6) Wie oft bestellt Ihr Euch was?
Praktisch nie. Pizza holen wir um die Ecke beim Dolce, weil es da eine der besten Steinofenpizzen Berlins gibt. Und die liefern nicht.
7) Zu 5 und 6: Wenn es keine finanziellen Hindernisse gäbe, würdet ihr das gerne öfters tun?
Nö. Spätestens nach zwei, drei Tagen ohne selbstgekochtes Essen drängt es mich sowieso in die Küche.
8) Gibt es bei Euch so was wie „Standardgerichte“, die regelmäßig auf den Tisch kommen?
Das wären Krautshäuptchen, das Pörkölt, das wir Gulasch nennen, Huhn á la Mére Dingsbums (das mit den mindestens 40 Knoblauchzehen) und der Kartoffel-Quark-Auflauf. Und – allerdings nur einmal pro Jahr – der klassische Gänsebraten. Andere Eckpfeiler meines Küchenprogramms sind Pasta, Sauerkraut und Senfsauce, jedoch niemals auf einem Teller. Und meistens koch ich sowieso nicht nach Rezept sondern aus der Lamäng.
9) Hast Du schon mal für mehr als 6 Personen gekocht?
Ja. Bei mir zuhause in der Küche schon mal für 30 bis 40 Leute. Und vor bald dreißig Jahren hab ich mal ’ne ganze Weile in der Kneipe im Restaurant in einer Art Speisegaststätte gekocht.
10) Kochst du jeden Tag?
Wenn irgend möglich, ja. Kochen ist für mich die beste Entspannung. Wenn ich in die Küche gehe, wird alles andere unwichtig. Was im Büro war, beim Seminar, beim anstehenden Projekt… spielt alles keine Geige mehr. Dann kommt’s nur noch drauf an, dass die Sauce gelingt. Dass das Fleisch auf den Punkt gar wird. Dass ich die richtige Menge Thymian erwische…
11) Hast Du schon mal ein Rezept aus dem Kochblog ausprobiert?
Äh… aus welchem Kochblog? Grundsätzlich ja und nein. Meistens koch ich nicht nach Rezept. Ich les wo was, und dann geh ich in die Küche und mach das irgendwie nach. So wie Alfredchen mit aufgeschlagenem Kochbuch die Zutaten teelöffelweise abmesse wäre nun gar nix für mich.
12) Wer kocht bei Euch häufiger?
Ich.
13) Und wer kann besser kochen?
Ich. Wobei die geduldigste Gemahlin durchaus ihr Revier verteidigen kann. Gegen ihre „Schnellen Tomatennudeln“ kann ich nicht anstinken, um nur ein Beispiel zu nennen. Und das wertvolle Rezept für den Kartoffel-Quark-Auflauf hat sie mit in die Ehe gebracht.
14) Gibt es schon mal Streit ums Essen?
Nein. Wir streiten nicht. Wir führen gediegene Auseinandersetzungen auf allerhöchstem Niveau. Und bei den wirklich wichtigen Dingen – also dem Essen – herrscht sowieso grundsätzlich Einigkeit.
15) Kochst du heute völlig anders, als Deine Mutter / Deine Eltern?
Ja. Nicht zuletzt, weil das Angebot an Lebensmitteln und Zutaten heute wesentlich größer ist als es in meiner Jugend war. Meine Mutter musste mit dem zurechtkommen, was sie damals in einer Kleinstadt bekommen konnte. Was es zum Beispiel nicht gab: Creme Fraiche, frische Pilze, Croissants, Olivenöl, frische Kräuter außer Petersilie, Schnittlauch und Dill, Chilischoten, exotische Gewürze, asiatische Zutaten… Die Liste ist bei weitem nicht komplett.
16) Wenn ja, isst Du trotzdem gerne bei Deinen Eltern?
Leider leben meine Eltern schon lange nicht mehr. Ich würde alles in der Welt hergeben, um noch einmal am Tisch meiner Mutter sitzen zu dürfen.
17) Bist Du Vegetarier oder könntest Du Dir vorstellen vegetarisch zu leben?
Nö. Ich esse gern Fleisch. Muss aber auch nicht jeden Tag sein.
18) Was würdest Du gerne mal ausprobieren, an was Du Dich bisher nicht rangewagt hast?
Fugu essen. Ganzen Ochsen am Spieß braten. Und – wenn ich denn an eine heran käme – eine Hammelkeule. Nein, keine Lammkeule. Ich rede von einer Hammelkeule, die erst mit einem mehrtägigen Buttermilchbad gefügig gemacht werden muss. Versuche ich seit Jahren erfolglos zu bekommen. Gibt augenscheinlich keine Hammel mehr, sondern nur noch Lämmer. Meine Mutter hat eine Hammelkeule gemacht, die… Seufz.
19) Kochst Du lieber oder findest Du Backen spannender?
Ich koche mit Leib und Seele. Gelegentlich – wenn ich die Zeit habe – backe ich Brot. Das macht auch Spaß, ist aber längst nicht so (ent)spannend wie eine gescheite Koch-Session.
20) Was war die größte Misere, die Du in der Küche angerichtet hast?
Ich hatte eine Mordserkältung, Nase zu, nix mehr gerochen und geschmeckt. Dachte, dass ich mit einem schönen Chili Con Carne den Geschmacksnerven auf die Hufe helfen könnte. Also ein Chili angesetzt, an den Computer gesetzt, gearbeitet, die Zeit vergessen… Plötzlich klingelt es Sturm. Besorgte Nachbarn stehen vor der Tür, wollen mich retten, unsere Wohnung stehe wohl in Flammen. Tatsächlich drangen leichte Rauchfahnen aus der Küche, wo die Flüssigkeit im vergessenen Chilitopf verkocht und die roten Bohnen verkohlt waren. „Das müssen Sie doch gerochen haben!“ Nö. Hatte ich nicht. Aber als der Geruchssinn 24 Stunden später langsam wiederkam, hat die Wohnung immer noch bestialisch gestunken. Und das ganze Haus hat’s gerochen…
21) Was essen Deine Kinder am liebsten?
S. 2
22) Was mögen Deine Kinder überhaupt nicht?
S. 21
23) Was magst Du überhaupt nicht?
Übertriebenes Getue ums Essen, egal ob im Restaurant oder im Haushalt. Essen ist wichtig und macht Spaß, aber sowie es zum Selbstzweck wird, schmeckt es mir nicht mehr.
So, Stöckchen fertig, dann muss ich es nur noch weiter werfen. Petras Antworten würden mich interessieren, und ich glaube, dass dem geschätzten Herrn Matla einiges einfallen wird.
Schnittfestes Schneidbrett
Zur Zeit bietet ein bekannter Kaffeeröster in seinem aktuellen Sortiment für „nur“ 9,99 € zwei Schneidbretter aus Glas (!) an und protzt auch noch mit der Produktbeschreibung: „Das hochwertige Sicherheitsglas ist schnitt- und kratzfest“.
Nu stelle mir uns ma jonz domm: War ist eigentlich ’ne scharfe Messerklinge? ’ne scharfe Messerklinger ist letztlich ein schmaler, V-förmiger Grat, der, wenn richtig scharf, durch angemessen weiches Material einigermaßen mühelos hindurch schneidet. Und was passiert, wenn dieser schmale Grat auf etwas trifft, das so hart ist, dass er es nicht schneiden kann, wie z. B. schnitt- und kratzfestes Sicherheitsglas? Richtig. Er knickt um. Und was ist ein Messer mit umgeknicktem Grad? Wieder richtig, stumpf.
Ein Schneidbrett muss aus Material sein, in dass das Messer hineinschneiden kann (Holz, Kunststoff). Glas oder Marmor (auch des öfteren zu sehen) sind zwar dekorativ, machen aber auch das schärfste Messer nach dem ersten Schnitt stumpf.
Was müssten wir also tun, um uns diese Schneidbretter aus Sicherheitsglas zu kaufen? Da müssten wir uns ja janz domm stellen! Und das wollen wir doch nicht, oder?
Kleine Werbung am Rande: Dieser Tipp steht auch im von mir mit verfassten „Ratgeber für den faulen Haushalt„.
Kartoffel-Quark-Auflauf
Ein Rezept, das die geduldigste Gemahlin von allen in die erfolgreiche Beziehung mitgebracht hat: Kartoffelquarkauflauf. Für vier Personen braucht man 1 kg gekochte Pellkartoffeln, 500g Magerquark 1/8 Liter süße Sahne, 3 Eier, ca. 80g Butter, 250g Schinkenspeck, Salz, Pfeffer und so viel Schnittlauch, wie die Haushaltskasse erlaubt und noch etwas Butter für die Auflaufform. Der Quark wird mit der Sahne, den Eiern und der zimmerwarmen Butter geschmeidig gerührt, vorsichtig gesalzen (Schinkenspeck), mutig gepfeffert und verschwenderisch mit kleingeschnittenem Schnittlauch durchsetzt. Die Kartoffeln werden gepellt und in Scheiben geschnitten, mit dem in Würfel geschnittenen Schinkenspeck vermischt, in eine gebutterte Auflaufform verfrachtet, mit dem Quarkgemisch übergossen und bei ca. 160 bis 180 Grad für 40 Minuten in den Ofen verfrachtet. Gelegentlich nachsehen, Hitze gegebenenfalls herunterdrehen, der Auflauf ist in Bestform, wenn die Eier den Guss nicht stocken lassen, sondern zu cremiger Konsistenz verhelfen.
Trotz – oder gerade – wegen seiner Einfachheit ist dieses Teil bei uns ein Dauerbrenner. Und das Rezept hat eine Besonderheit: Man kann es nicht verbessern. Alle Versuche, diesen Auflauf durch kleine oder große Veränderungen zu verbessern, sind krachend gescheitert: Mehr Sahne machte ihn zu mächtig, Creme Fraiche statt Sahne machte ihn zu vornehm und der Versuch, das ganze mit Krabben in eine eher norddeutsche Richtung zu drehen, war letztlich interessant, führte jedoch zu einem vollkommen anderen Gericht. Schon ziemlich bald habe ich also gelernt, meinen Küchenaktionismus an anderen Gerichten als diesem auszutoben. Dieser Vierklang aus Kartoffeln, Schinkenspeck, Eierquarksahne und Schnittlauch ist in sich perfekt und gefestigt, wie die Beziehung zur geduldigsten Gemahlin von allen. Besser geht’s nicht!
Schweinerei
Warum wir die Schweinerei so nennen, weiß bei uns kein Schwein mehr. Auf alle Fälle hab ich das Rezept mal bei Biolek gesehen, hab’s ein wenig abgewandelt, und wenn wir Leute einladen, für die ich’s schon mal gemacht habe, fragen die immer: „Macht ihr wieder diese leckere Vorspeise mit den Feigen?“ Aber gerne!
Pro Nase braucht’s ein oder zwei getrocknete Feigen und ein, zwei oder drei Garnelenschwänze (je nach Größe), ein paar dünne Scheiben rohen Schinken (gern Serrano oder Parma, muss aber nicht) sowie Olivenöl, Senf und Zitronensaft. Aus den letzteren 3 Zutaten rührt man eine nicht zu säuerliche Marinade und legt darin die (selbstverständlich entpanzerten) Garnelenschwänze und die getrockneten Feigen (wenn Stiel zu hart, abzwacken) ein paar Stunden ein (Kühlschrank). Wenn man das Marinieren in einen Gefrierbeutel verlegt, braucht man nicht viel Marinade. Anschließend das Zeugs abtropfen lassen (Marinade auffangen), Garnelen und Feigen mit Schinken umwickeln und in der Pfanne in etwas Olivenöl knusprig braten. Mit der restlichen Marinade bekleckern und mit einem Büschel Salat und etwas Weißbrot servieren. Mahlzeit!
Gänsekeulen mit karamelisiertem Weißkohl
Das hab ich zum ersten Mal bei Ulrike und Harald gegessen. Und seitdem koch ich’s selber immer wieder. Für vier Gänsekeulenesser braucht man: 4 Gänsekeulen, ca. 1 kg Weißkohl, 3 Äpfel, ca. 4 Esslöffel braunen Zucker, frischen Meerettich, Salz und Pfeffer.
In einem flachen Bräter ohne zusätzliches Fett die Keulen bei allerhöchstens mittlerer Hitze langsam anbraten (10 bis 15 Minuten), so dass das Gänsefett ausbrät. Wenn die Keulen braun sind, rausnehmen, Fett bis auf 2 Esslöffel abgießen, den braunen Zucker reingeben und karamelisieren lassen. Den entstrunkten und feingeschnittenen Weißkohl dazugeben, kurz durchdünsten, mit 3/8l Wasser ablöschen, salzen und pfeffern. Gänsekeulen ins Kohlbett, Deckel drauf und bei 180 Grad eine Stunde lang im Ofen in Ruhe lassen. Deckel ab und nochmal 30 Minuten offen im Ofen garen lassen. Äpfel schälen, entkernhäusern und in Spalten schneiden. Die Apfelspalten in den letzten 15 Minuten auf dem Kohlbett mitgaren lassen. Großzügig mit frisch geriebenem Meerettich bestreuen und servieren. Bratkartoffeln kommen sehr gut dazu. Mahlzeit!
Blunzengeröstel
Das Rezept fürs Blunzenparfait war blogtechnisch ein ziemlicher Erfolg, weil es zu nächtlicher Stunde gesprächsstiftend gewirkt und mich mit einigen sehr netten Menschen zusammengebracht hat. Da dies nur an der segenspendenden Wirkung der Blutwurst liegen kann, schiebe ich heute ein weiteres Blutwurstgericht nach, das Blunzengeröstel. Für 4 Personen benötigt man 2 bis 3 Pfund Kartoffeln, zwei bis drei Zwiebeln, ein Stück durchwachsenen Speck, Schweineschmalz, frisch geriebenen Meerrettich und – natürlich – nicht zu knapp Blutwurst. In Berlin kann es durchaus ein Problem sein, Blutwurst zu bekommen, die geschmacklich akzeptabel ist und sich braten lässt. Die meisten Berliner Fleischer bieten ausschließlich die kleinen Blutwürstchen für das Traditionsgericht „Blut- und Leberwurst auf Sauerkohl mit Pürree“ an, und diese kleinen Blutwürste laufen, von der Pelle befreit, in der Pfanne schneller auseinander als am 1. Mai die schwäbischen Krawalltouristen, wenn sie einen Wasserwerfer sehen.
Da hat’s überraschenderweise derjenige gut, der nicht all zu weit von Neukölln wohnt, denn hier, beim Fleischermeister Marcus Benser gibt es die beste Blutwurst Berlins, Deutschlands, Europas, evendöll der Welt. Blutrote Poesie in der Pelle! Nein, ich übertreibe nicht.
In der heimischen Küche werden erstmal die Kartoffeln in der Schale gekocht, die Zwiebeln und der Speck gewürfelt. Eine Pfanne – vorzugsweise aus Eisen – wird auf mittlere Betriebstemperatur gebracht – Schweineschmalz wird erhitzt und die mittlerweile geschälten und in Scheiben geschnitten Kartoffeln werden hineingeworfen und gemeinsam mit dem Speck und den Zwiebeln zu Bratkartoffeln verarbeitet. Die Kartoffeln sollten möglichst alle nebeneinander in der Pfanne Platz haben, damit sie braten und nicht dünsten, und die Hitze sollte nicht zu groß sein. Nach 15 bis 20 Minuten sollten die Kartoffeln außen kross und innen cremig sein, selbstverständlich hat man gesalzen und gepfeffert. Kurz vor der Vollendung der Bratkartoffeln hat man eine zweite Pfanne auf den Herd gesetzt und die Blutwürste gepellt und in dicke Scheiben geschnitten. Die werden jetzt in der Pfanne ratzfatz von beiden Seiten kross gebraten. Da die meisten Blutwürste von sich aus schon recht fettig sind (Fett ist unser Geschmacksträger Nummer 1! Wir sagen ja zu deutschem Fett!), sollte das ohne weitere Fettzugabe funktionieren. Ängstliche Naturen lassen die Blutwurststücke kurz auf Küchenkrepp abtropfen, bevor sie mit den Bratkartoffeln vermischt werden, unerschrockene Lebenskünstler, die wissen, was gut schmeckt, kippen ohne mit der Wimper zu zucken auch noch das aus den Blutwürsten ausgetretene leckere Bratfett zu den Kartoffeln. Über das fertige Blunzengeröstel wird jetzt noch nach Geschmack frisch geriebener Meerrettich gestreut. Wohl dem, der einen richtig scharfen Meerrettich erbeuten konnte (wird immer schwieriger), denn die Schärfe setzt den nötigen Kontrapunkt zu den sanften Bratkartoffeln und der deftigen Gemütlichkeit der gebratenen Blunze. Jetzt kann serviert und die Getränkefrage geklärt werden. Bier ist bei diesem Gericht natürlich immer eine Option. Auch ein Rotwein könnte passen, ein Zweigelt vielleicht… Vielleicht wäre ein Weißwein die beste Option. Ich trink am liebsten einen Welschriesling aus dem Burgenland dazu. Dessen frische Säure, die Schärfe des Meerettichs, das sanfte Blutwurstkartoffelgemisch… Hach.
Blunzenparfait
„Blunzen“ ist ein österreichischer Ausdruck für Blutwurst und „Parfait“ ist französisch und heißt „perfekt“. In der Tat ist das folgende Rezept die perfekte Vorspeise für den Blutwurstabkönner. Für 4 dieser Gestalten benötigt man – was Wunder! – mindestens 250g Blutwurst, eine kleine Zwiebel, zwei Knoblauchzehen, etwas Butter und einen Viertelliter Bouillon oder Fond (Kalb, Rind, Huhn, welcher ist wurscht, Fisch wäre wohl doch etwas kühn). Zwiebeln und Knoblauch schälen und feinwürfeln, in Butter andünsten, gepellte und gewürfelte Blutwurst dazu, andünsten und mit der Bouillon auffüllen, bis knapp bedeckt. 5 bis 10 Minuten kochen lassen, eventuell salzen und pfeffern und mit dem Stabmixer zermusen. In eine Schüssel umfüllen und nach dem Abkühlen im Kühlschrank fest werden lassen. Eine Stunde vor dem Servieren aus dem Kühlschrank nehmen, Zimmertemperatur annehmen lassen, mit dem Esslöffel Blunzenparfaitnocken abstechen und mit Rahmgurken (Salatgurke schälen, entkernen, würfeln, mit Creme Fraiche, Salz, Pfeffer und Schnittlauch – meinethalben auch Dill, wer’s mag – verrühren) servieren.
Das ist genauso simpel zu machen, wie es klingt und schmeckt seeeeehr lecker. Wenn man Blutwurst mag, wie gesagt. Für das Rezept bin ich übrigens dem Herrn Lentsch von der Dankbarkeit sehr dankbar. Da hab ich’s auch zum ersten Mal gegessen, und dazu den wunderbaren weißen Hauswein getrunken, den der Herr Lentsch selber macht und der daher wunderbarer Weise auch „Dankbarkeit“ heißt.
Rosenkohlblätter
Gestern hab ich beim Einkaufen gesehen, dass die Rosenkohl-Saison bereits in vollem Gange ist. Das bringt mich auf folgendes:
Es ist bestimmt über 20 Jahre her, seit ich zum ersten Mal in einer Freßzeitschrift (war es Siebeck, der darüber schrieb?) las, das Rosenkohl zu einer ganz besonderen Delikatesse wird, wenn man die Blätter einzeln von den Röschen zupft, sie kurz blanchiert und dann weiter verarbeitet, also z.B. in Butter schwenkt oder mit einer Vinaigrette zum Salat veredelt. „Könnte tatsächlich ganz lecker sein!“ reflektierte ich seinerzeit, kaufte ein Pfund Rosenkohl und fing mit der Zupferei an. Nach einem halben Röschen hab ich aufgegeben. Das Abzupfen der einzelnen Blätter war eine dermaßen zeitaufwendige, nervtötende, fummelige Fieselei… Da hab ich dann doch lieber ein sahniges Püree gemacht.
Später hab ich dann mal im Restaurant ein solches Rosenkohlblätter-Gemüse gegessen. War ganz okay, und wenn ich ein Restaurant hätte, wo ich den aufmüpfigen Lehrling aus Disziplinierungsgründen ein paar Stunden zum Blätterzupfen in die Ecke stellen könnte, würde ich öfters eine derartige Beilage auf die Karte setzen. Aber zuhause? No go!
Trotzdem ergibt eine Google-Suche nach „Rosenkohlblätter Rezept“ immerhin noch beeindruckende 647 Treffer. Frage: Zupft tatsächlich wer in der heimischen Küche? Oder gibt es einen Trick?