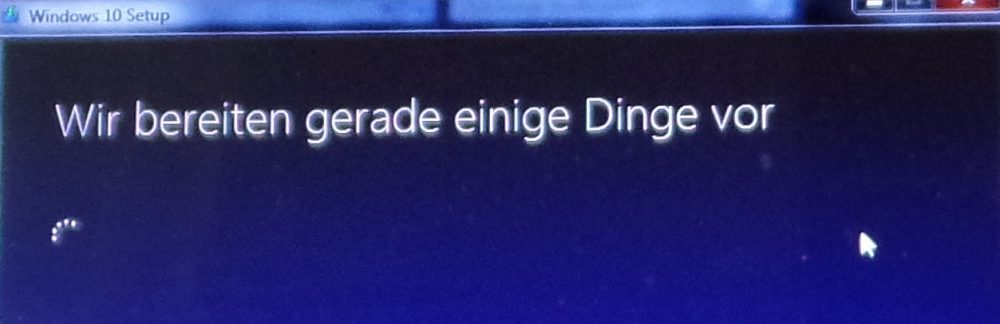Archiv des Liberalismus, Bestand Audiovisuelles Sammlungsgut, F5-1 / CC-BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Anfang der 70er Jahre waren wir alle politisch. Als 1969 Willy Brandts sozialliberale Koalition begann, den Muff von 20 Jahren CDU-Vorherrschaft wegzupusten, als mit den Ostverträgen „Wandel durch Annäherung“ versucht wurde, kurz, als die Dinge sich tatsächlich zu verändern begannen, ließ das niemanden kalt. Wir begannen, nachzudenken, bezogen Stellung, diskutierten … die Dinge erschienen auf einmal veränderbar, und man wollte mitmachen, mit verändern, sich einbringen. Es war eine schöne, sehr aufregende Zeit, in der ich zu überlegen begann, ob nach Abitur und Studium die Politik nicht etwas für mich wäre..
Ich schloss mich Anfang der 70er Jahre den Jungdemokraten an. Die Ideen des Liberalismus beseelten den idealistischen jungen Kerl, der ich damals war, und die Judos hatten damals ein großes Thema, das mich umgetrieben hat: die Trennung von Kirche und Staat. Ich empfand die Privilegien, die die evangelischen und katholischen Kirchen hierzulande genossen und weidlich ausnutzten als schlichtweg inakzeptabel, ebenso wie die Rollen, die sie im öffentlichen Diskurs spielten.
1973 fand der Landesparteitag der hessischen FDP in Eschwege statt, unser Ortsverband organisierte die Veranstaltung, und meine Aufgabe war es, die Abstimmungen auf dem Parteitag zu organisieren. Ich musste Wahlhelfer beschaffen und einweisen, die die Stimmzettel einsammelten, musste darauf achten, dass alles ordnungsgemäß ablief, die Ergebnisse übermitteln etc. Das klappte ganz gut, die ganze Sache war auch nicht sonderlich schwer zu managen. Als Gegenleistung für mein Engagement dürfte ich mir eine Begegnung mit einem FDP-Politiker wünschen, der am Parteitag teilnahm. Ich hab keine tausendstel Sekunde überlegt und bat um ein Gespräch mit Karl-Herrmann Flach. Flach war damals der Superstar des Linksliberalismus, er war der spiritus rector hinter den „Freiburger Thesen“, und sein Buch „Noch eine Chance für die Liberalen“ hatte ich mehrmals gelesen.
Kurz nach dem Schlusswort des Parteitags war es dann so weit, ich wartete im „Zählzimmer“ hinter der Bühne der Eschweger Stadthalle, und dann flog die Tür auf und Karl-Hermann Flach kam herein. „Ich habe höchstens eine Viertelstunde, was wollen Sie wissen?“
Natürlich hatte ich mir gut überlegt, was ich Flach fragen wollte, und so sprach ich das damals aktuelle „Kirchenpapier“ der Jungdemokarten an, in dem wir die Trennung von Kirche und Staat forderten, und fragte ihn, wie man diese Trennung in die Wirklichkeit umsetzen könne. Mit allen möglichen Antworten hatte ich gerechnet, aber nicht mit der, die Herr Flach mir gab: „Gar nicht. Das ist kompletter Unfug, den Sie vergessen sollten. Wenden Sie sich anderen Dingen zu!“
Wenn er beabsichtigt hatte, mir jegliche Scheu vor sich zu nehmen und mich auf hundertachtzig zu bringen, war ihm das gelungen. Natürlich widersprach ich dem „Unfug“ und verteidigte unser politisches Anliegen. Aus der Viertelstunde, die Flach mir zugestanden hatte, wurde ein anderthalbstündiger Streit, der immer wieder von Flachs zum Aufbruch mahnendem Fahrer unterbrochen wurde. Flach argumentierte nicht in der Sache gegen mich: Die Trennung von Kirche und Staat wäre ein lobenswertes Ziel, das aber nicht verwirklicht werden könnte. Schon gar nicht von einer kleinen Partei wie den Liberalen, die ein derart fundamentales Vorhaben nur mit Verbündeten umsetzen könnte, und die würden sich nicht in der SPD und schon gar nicht bei der CDU finden lassen. Niemand würde es sich mit der eigenen, christlich orientierten Klientel verscherzen wollen. Und noch viel wichtiger: Wenn man auch nur versuchen würde, ein solches Vorhaben in die Tat umzusetzen, würde man eine riesige Angriffsfläche bieten, und die Angreifer konnten sich der Unterstützung der mächtigen Kirchen sicher sein. Ein Vorhaben wie die Trennung von Kirche und Staat sei schlicht nicht realisierbar.
Dieser Argumentation hatte ich – außer meinem plötzlich ein wenig deplatziert wirkenden Idealismus – wenig entgegenzusetzen. Und auf meinen Einwand „Die Mitbestimmung der Arbeitnehmer war doch vor ein paar Jahren auch noch eine reine Utopie, was ist da der Unterschied zur Trennung von Kirche und Staat?“ hatte Flach auch eine Antwort: „Die Mitbestimmung einzuführen, hat sich als eine Frage der Vernunft erwiesen. Das kann man öffentlich mit Gewinn diskutieren. Bei der Kirche ist immer etwas Irrationales mit im Spiel, auf das Terrain will man sich nicht begeben.“
Als Herr Flach sich nach anderthalb Stunden verabschiedete, war ich einigermaßen verdattert. Ich hatte mir von ihm etwas gänzlich anderes erwartet als eine Lehrstunde in politischem Pragmatismus. Aber ich musste mir auch eingestehen, dass ich seiner Argumentation nichts entgegenzusetzen gehabt hatte: Der Mann hatte in der Sache schlicht recht gehabt und meinem Idealismus die Grenzen aufgezeigt. Ich beschloss, mir für ein weiteres Treffen – das Flach mir beim Abschied versprochen hatte – etwas einfallen zu lassen und mich besser vorzubereiten.
Dazu kam es dann nicht mehr. Nur wenige Wochen später saß ich geschockt vor dem Fernseher, als in der Tagesschau sein plötzlicher Tod vermeldet wurde: Schlaganfall. Das war ein immenser Verlust, und ich frage mich heute noch, wie anders sich dieses Land und die FDP entwickelt hätten, wenn Flach nicht so früh gestorben wäre.
Das anderthalbstündige Gespräch mit diesem außergewöhnlichen Mann hat mein Leben und Denken nachhaltig geprägt. Je mehr Jahre vergingen, desto klarer wurde mir, wie Recht Flach gehabt hatte. Von der Trennung von Kirche und Staat sind wir heute noch beinahe genauso weit entfernt, wie damals, auch wenn der Einfluss der Kirchen mittlerweile deutlich geringer ist als damals. Wie wichtig Pragmatismus ist, hat Flach nachhaltig in meinem Denken verankert. Heute weiß ich, dass die dollsten idealistischen Ideen nur Stammtischparolen bleiben, wenn man keinen Weg weiß, wie man aus ihnen Wirklichkeit machen kann. Und weil mir noch als Jugendlicher klar wurde, dass meine Ideen sich meist einen Scheiß darum scherten, ob sie in die Wirklichkeit passen oder nicht, hab ich das mit der Politik sein lassen und bin zum Theater gegangen. War damals eine gute Entscheidung, die ich auch der Kopfwäsche von Karl-Hermann Flach zu verdanken habe.